|
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Kreisvereinigung Münster |
|
02. November 2004 "Kein Tag vergeht, ohne dass die schreckliche Erinnerung zurückkommt" Zeitzeuge Jules Schelvis berichtete über das Konzentrationslager Sobibor
Auf Einladung des AStA der Fachhochschule Münster, der ESG und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten Münster (VVN/BdA) war Jules Schelvis, Zeitzeuge und Überlebender der faschistischen Konzentrationslager, am vergangenen Dienstag in Münster zu Gast.
Jules Schelvis selbst hatte Glück. Nur weil es ihm in letzter Minute gelang, sich einer Gruppe von 80 Arbeitshäftlingen anzuschließen, konnte er das Lager lebend verlassen. Nach Aufenthalten in insgesamt zehn nationalsozialistischen Konzentrationslagern, nach Schwerstarbeit und entwürdigen Bedingungen, wird Schelvis im März 1945 von den Franzosen befreit. Einen Schwerpunkt dieses Abends legte Schelvis auf die Ereignisse in Sobibor. Schelvis ergänzte in seinem Bericht eigene Erlebnisse in Sobibor durch Zeugenaussagen aus den Sobibor-Prozessen der Nachkriegszeit und stellte detailliert die Geschichte des Lagers sowie den historischen und politischen Hintergründe des Vernichtungslagers Sobibor dar. Schelvis ging auch ausführlich auf die Selbstbefreiung des Konzentrationslagers durch jüdische Häftlinge ein. Im Juli 1943 bildete sich eine Gruppe von Häftlingen, die einen Aufstand planten, der dann im September 1943 umgesetzt wurde. Bei diesem Aufstand konnten 300 Häftlinge fliehen, etwa zwölf SS- Männer wurden von den Aufständischen umgebracht. Dieser Aufstand in Sobibor ist ein Beispiel des in der Öffentlichkeit häufig bestrittenen jüdischen Widerstandes gegen den Faschismus. Der AStA der Fachhochschule und die VVN/BdA setzten mit dieser Veranstaltung ihr Bemühen fort, die Auseinandersetzung mit dem historischen Faschismus mittels Zeitzeugenberichten zu fördern und daraus Konsequenzen für das aktuelle politische Handeln zu entwickeln. Die Veranstalter haben sich eine Aussage Schelvis sehr zu Herzen genommen: „Fest steht, wenn wir gestorben sind, dann wird niemand mehr da sein um zu erzählen, wie es wirklich war ... Ich finde es wichtig, dass jetzt noch mehr deutschsprachige Menschen davon Kenntnis nehmen können, was in Sobibor passiert ist“. |

 Auschwitz-Birkenau
gilt weltweit als das Symbol für den Holocaust. Doch die Ermordung
der europäischen Juden fand nicht nur dort statt. Belezec, Sobibor
und Treblinka gehören zu den oftmals vergessenen Vernichtungslagern
des Holocaust. Unter dem Codenamen „Aktion Reinhard“ ermordeten
die Nationalsozialisten 1942 und 1943 dort über 1.5 Millionen
jüdische Menschen im heutigen Ostpolen.
Auschwitz-Birkenau
gilt weltweit als das Symbol für den Holocaust. Doch die Ermordung
der europäischen Juden fand nicht nur dort statt. Belezec, Sobibor
und Treblinka gehören zu den oftmals vergessenen Vernichtungslagern
des Holocaust. Unter dem Codenamen „Aktion Reinhard“ ermordeten
die Nationalsozialisten 1942 und 1943 dort über 1.5 Millionen
jüdische Menschen im heutigen Ostpolen.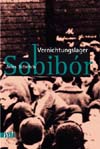 Jules
Schelvis las an diesem Abend aus seinem Buch „Sobibor“ (
Jules
Schelvis las an diesem Abend aus seinem Buch „Sobibor“ (